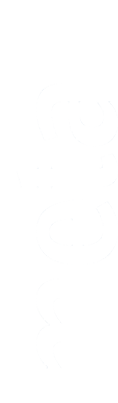Entscheidung – Ein zweischneidiges Schwert
Führung
Um etwas bewegen zu können, müssen wir entscheiden. Das bedeutet im Gegenzug, dass wir uns damit gleichzeitig von allenfalls interessanten Alternativen trennen müssen. Wankelmütige Zeitgenossen, die kurz nach der Entscheidung ihre Meinung wieder wechseln oder den Prozess künstlich in die Länge ziehen, sind wahre Effizienzkiller.
Login
Danke für Ihr Interesse an unseren Inhalten. Abonnenten der Fachzeitschrift metall finden das Login für den Vollzugriff im Impressum der aktuellen Printausgabe. Das Passwort ändert monatlich.
Jetzt registrieren und lesen. Registrieren Sie sich um einzelne Artikel zu lesen und einfach per Kreditkarte zu bezahlen. (CHF 5,- pro Artikel)
Als registrierter Benutzer haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre gekauften Artikel.
Sollten Sie als interessierte Fachkraft im Metall-, Stahl- und Fassadenbau die Fachzeitschrift metall tatsächlich noch nicht abonniert haben, verlieren Sie keine Zeit und bestellen Sie Ihr persönliches Abonnement gleich hier.
Was bedeutet eigentlich «entscheiden»? Unabhängig davon, ob es sich um persönliche oder berufliche Situationen handelt, wichtig ist, dass entschieden und dann durchgezogen wird.
Hirnforscher gehen davon aus, dass der Mensch schätzungsweise 20 000 Entscheidungen pro Tag trifft, viele davon unbewusst. Das Wort «entscheiden» stammt gemäss Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, vom Wortstamm «sceidan» respektiv «intsceidôn» und bedeutet so viel wie «aus der Scheide ziehen» oder «trennen». Man trennt sich beim Entscheiden also von verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, was wiederum voraussetzt, dass fürs Entscheiden mindestens zwei Handlungsoptionen vorhanden sein müssen.
Jeder Entscheidung geht ein Entscheidungsprozess voraus. Er umfasst im Wesentlichen eine Erfassung der Ist-Situation, eine Zielsetzung und die Informationsbeschaffung respektive -auswertung. Es gilt, die gefundenen Möglichkeiten zu bewerten und daraus die bestmögliche Lösung abzuleiten. In vielen Fällen heisst Entscheiden gleichzeitig auch bewusst auf Alternativen zu verzichten. Dies kann vor allem dann eine Herausforderung darstellen, wenn auch für die Alternativen überzeugende Gründe sprechen. Oftmals ist man in solchen Situationen gut damit beraten, nicht nur harte Faktoren und somit den Kopf in den Entscheidungsprozess miteinzubeziehen, sondern auch auf den Bauch zu hören. Unser Unterbewusstsein entscheidet interessanterweise oftmals schneller und instinktiv richtig, während der Kopf immer noch damit beschäftigt ist, zuerst sämtliche rational hergeleiteten Fakten gegeneinander abzuwägen.
Welche Konsequenzen bringen Entscheidungen mit sich?
Jeder Entscheid kann sich zwangsläufig für oder gegen ein Individuum oder eine Organisation auswirken. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum sich viele Entscheidungsträger schwertun, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Da selten 100% der Informationen vorliegen, bleibt in vielen Fällen die Ungewissheit, ob man sämtliche entscheidungsrelevanten Faktoren berücksichtigt hat. Nehmen wir zum Beispiel den Anspruch an ein ideales Preis-Qualitäts-Verfügbarkeits-Verhältnis: Entscheide zugunsten des Preises gehen häufig zu Lasten der Qualität. Entscheide zugunsten der Qualität gehen oft zu Lasten der schnellen Verfügbarkeit. Und eine schnelle Verfügbarkeit kann sich, z.B. aufgrund teurer Investitionen in die Infrastruktur, negativ auf den Preis auswirken.
Das Verschieben oder Verzögern von Entscheidungen ist selten eine Lösung. Ich erinnere mich an eine meiner Tätigkeiten für einen Konzern. Frei nach dem Pareto-Prinzip lagen bei Grossinvestitionen in 20% der Zeit rund 80% der entscheidungsrelevanten Grundlagen bereit. Anstatt sich aber damit zu begnügen, wurden weitere 80% der Zeit in die restlichen 20% der Grundlagen investiert, welche, so ganz nebenbei bemerkt, nie dazu geführt haben, dass ein Entscheid anders ausgefallen wäre. Kommagenaue Abschätzungen und perfekte Power-Point-Präsentationen waren somit eine willkommene Möglichkeit, den Entscheidungsprozess in die Länge zu ziehen. Hauptgrund dieses Missstandes waren somit nicht die scheinbar so wichtigen fehlenden 20%, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich die verantwortlichen Personen nicht entscheiden wollten. Sie hatten schlicht Angst davor, einen Fehlentscheid zu treffen.