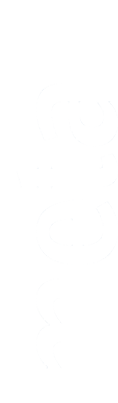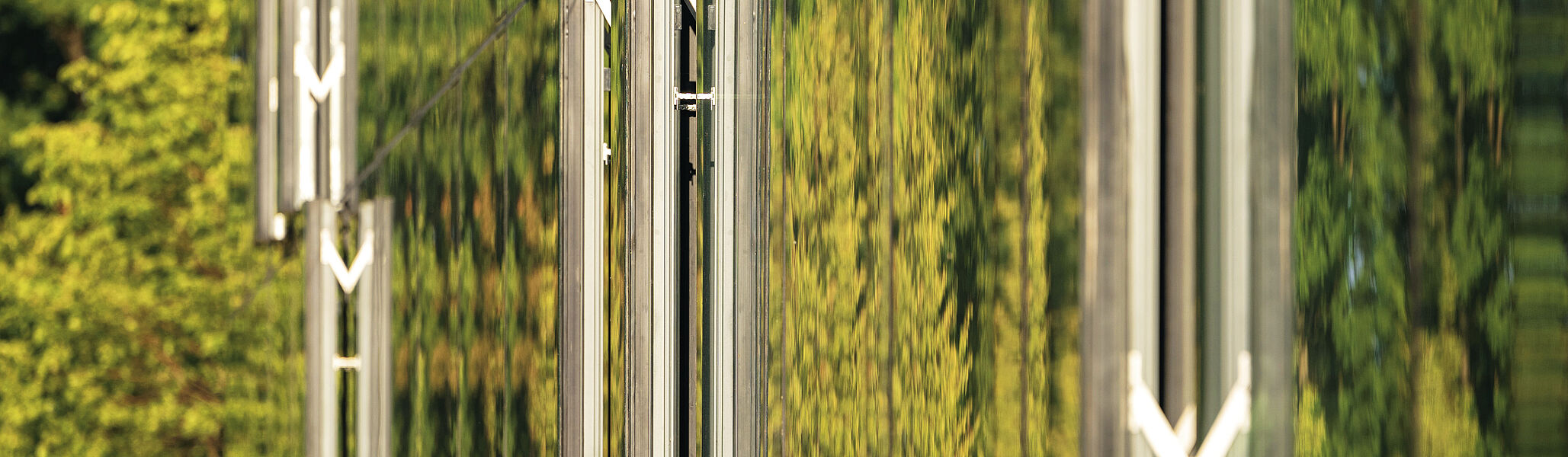

Zukunftsmarkt PV im Metallbau
Solartechnik
Photovoltaik ist ein Zukunftsmarkt: Der Strombedarf steigt, und das Ziel der Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen wird wichtiger. Manche Marktchance ist heute noch nicht völlig klar – und gerade deshalb wert, sie zu prüfen.
Login
Danke für Ihr Interesse an unseren Inhalten. Abonnenten der Fachzeitschrift metall finden das Login für den Vollzugriff im Impressum der aktuellen Printausgabe. Das Passwort ändert monatlich.
Jetzt registrieren und lesen. Registrieren Sie sich um einzelne Artikel zu lesen und einfach per Kreditkarte zu bezahlen. (CHF 5,- pro Artikel)
Als registrierter Benutzer haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre gekauften Artikel.
Sollten Sie als interessierte Fachkraft im Metall-, Stahl- und Fassadenbau die Fachzeitschrift metall tatsächlich noch nicht abonniert haben, verlieren Sie keine Zeit und bestellen Sie Ihr persönliches Abonnement gleich hier.
Solartechnik
Zukunftsmarkt PV im Metallbau
Photovoltaik ist ein Zukunftsmarkt: Der Strombedarf steigt, und das Ziel der Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen wird wichtiger. Manche Marktchance ist heute noch nicht völlig klar – und gerade deshalb wert, sie zu prüfen.
Photovoltaik gibt es mittlerweile in einer weiten Angebotsbreite vom Balkonkraftwerk über VHF-Konstruktionen bis zur Grossflächenanlage auf Parkplätzen oder Agri-PV. Allen gemein ist: Sie haben Potenzial und Zukunft, weil sich die Investition mit kostenlosem Strom refinanziert, zumindest teilweise. Zudem ist die regenerative Energie umweltfreundlich und wirkt somit positiv auf Klima und Image. Hürden gibt es jedoch auch: Ob sich eine PV-Anlage tatsächlich rechnet, ist gerade bei den derzeit niedrigen Einspeisevergütungen oft fraglich. Zudem sind Gewerkegrenzen zu beachten, die das Geschäft nicht einfacher machen. Es gilt also, etwas genauer hinzuschauen und Chancen und Risiken zu analysieren.
Balkon- und Vordach-Kraftwerke
Balkonkraftwerke liegen im Trend, gemeint sind genau genommen Solarpanels, an Absturzsicherungen von Balkonen montiert oder direkt als Absturzsicherung eingesetzt, beziehungsweise Geländer mit integrierten Photovoltaik-Modulen.
Die Installation ist meist relativ simpel und wird sogar schon als DIY-Bausatz angeboten (mit PV-Modul, Wechselrichter und Stromanschluss über die Steckdose). Zwei Argumente sprechen dafür, die Montage an Profis aus dem Metallbau zu geben: Statik und Windlast. Der Wind wirkt auf die Panels selbst und auf die Geländer, an die sie montiert werden. Die kleinen Kraftwerke und ihre Verankerung und die tragende Konstruktion sind entsprechend den örtlichen Windverhältnissen auszulegen, im Idealfall bereits in der Planung. Werden Balkonkraftwerke bei Bestandsbauten zum Beispiel an Füllstabgeländer montiert, erhöhen sie die ständige Last, und der Winddruck und/oder Windsog wirkt vollflächig über die Panels auf das Geländer. Das ist gegebenenfalls zu berechnen. Unter Umständen ist sogar eine Genehmigung erforderlich und für die Beurteilung der Tragfähigkeit ein Tragwerksplaner.
Kommen die Module als Absturzsicherung zum Einsatz, werden sie Teil der baulichen Anlage und sind damit ein Bauprodukt – wenn beispielsweise das PV-Element auch als Glasgeländer dient, also PV anstelle von VSG verbaut ist. Gerade solche umfangreichen Arbeiten sind nichts für Selbstbauer, hier ist der Metall- und Fassadenbauer gefragt.
Als kleine Anlagen bieten sich auch Vordächer an – hier gibt es längst vorgefertigte Bauteile, die sich einfach anstelle eines Standard-Glasvordachs montieren lassen.
Chance Selbstversorger
PV ist nicht nur als Geschäftsmodell zum Verkauf interessant, sondern auch als Stromquelle für den eigenen Betrieb. Trotz der deutlich gesunkenen Einspeisevergütung ist Sonnenstrom, richtig geplant, eine wirtschaftliche Lösung. Bernhard Hahner, Chef des Stahlbau-Spezialisten Hahner Technik aus Petersberg, rechnet vor allem die Ersparnis gegen. «Es geht darum, den eigenen Bedarf mit Solarstrom zu decken – kalkulatorisch setze ich also bei der eigenen PV-Anlage den Preis für die Kilowattstunde an, den ich durch sie nicht zahlen muss», erklärt er. Hahner beschäftigt sich schon seit rund 20 Jahren mit Photovoltaik. Seit den Boomjahren arbeitet deshalb auch ein Elektriker in der Firma. So bleibt bei einem PV-Auftrag die gesamte Wertschöpfung beim Metallbauer. Fehlt ein Elektro-Fachmann, empfiehlt Hahner, die Verlegung der Module nicht abzugeben, sondern den E-Handwerker nur beim Anschluss der Anlage (an den Wechselrichter) hinzuzuziehen – auch hier mit dem Ziel, Aufträge weitestgehend in der eigenen Hand abzuwickeln.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es dabei wichtig, die Marktentwicklungen genau zu beobachten. «Mit den deutlich günstigeren Modulen von heute rechnet es sich nicht mehr, Dachanlagen aufzuständern. Der höhere Aufwand gegenüber der Parallelverlegung zur Dachfläche amortisiert sich nicht mehr», nennt Hahner ein Beispiel für ein rückläufiges Geschäft. An anderen Stellen liegt dagegen noch Potenzial offen. Mit der Grundhaltung, PV nah am Verbrauchsort zu installieren, schaut der Fachmann auf die Dächer moderner Gebäude – genauer: auf die dort installierten Anlagen zur Klima- und Lüftungstechnik. «Die werden in der Regel mit einer Lamellen-Einhausung geschützt, eine klassische Aufgabe für Metallbauer», sagt Hahner. «Diese Bauteile sind bislang in der Regel nicht mit PV-Modulen ausgestattet. Dabei liegt doch hier alles beisammen: Ein Abnehmer mit Bedarf, ein Traggerüst und kurze Wege vom Modul zum Verbraucher. Optimal für Photovoltaik.»
Agri-PV
Wenn es um die Entwicklung grosser Anlagen geht, richtet sich Hahners Blick aufs Feld: Agri-PV, also der Bau von PV-Parks auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Ansätze dazu gibt es bereits viele. Umsichtig geplant, nehmen die Anlagen kaum Fläche in Anspruch und bieten sogar Vorteile für den Wuchs der Pflanzen – beispielsweise mit vertikal aufgebauten Modulwänden im Raster der landwirtschaftlichen Maschinen. «Die Stahlträger dafür bieten sich ideal für die serielle Fertigung an», meint Hahner. Auch im Obstbau entwickelt sich der Markt – sogar noch intensiver: Die temporären Schutzanlagen werden immer häufiger mit PV kombiniert, und auch hier kommen die Traggerüste im Idealfall vom Metallbauer. Wie die Betreibermodelle dann gestaltet werden (zum Beispiel gemeinsam mit dem Metallbauer), ist dann noch zu klären – und bietet weiteres Ertragspotenzial.
«Es geht darum, den eigenen Bedarf mit Solarstrom zu decken. Kalkulatorisch setze ich den Preis an, den ich nicht zahlen muss.»
Best practice: BIPV, die Fassade als Kraftwerk
Building integrated Photovoltaic (BIPV, bauwerkintegrierte Photovoltaik) umfasst einen ganzheitlichen Ansatz, nämlich die architektonische, bauphysikalische und konstruktive Einbindung von PV-Modulen in die Gebäudehülle, die die multifunktionalen Eigenschaften der Module berücksichtigt. Zur Stromgewinnung kommen Witterungsschutz, Wärmedämmung, Beschattung, Sichtschutz, Schalldämmung, elektromagnetische Schirmdämpfung, Lichtlenkung.
Hinweis der Redaktion: Solartechnik und Witterungsschutz – siehe auch «metall» vom Juli 25, Seite 4. «Fassade neu gedacht» (Solar-Schutzdächer am Gebäude Zwhatt).
Bürogebäude «Matchbox»
Ein aussergewöhnliches Beispiel steht seit 2024 in Eschborn: Das zehngeschossige Bürogebäude «Matchbox» ist mit seinen PV-Modulen und dem ruhigen Konstruktionsraster ein architektonisch ansprechender Bau. Energetisch hiess das Ziel: «Keine fossilen Energieträger» – und so gibt es neben einer Luft-Wasser-Wärmepumpe PV auf dem Dach und an der gesamten opaken Fassade. Die ist eine angepasste Sonderkonstruktion des hochwärmedämmenden Aluminiumfenstersystems Schüco AWS 75 BS.HI+, kombiniert mit dem bauwerkintegrierten Photovoltaik-System von Schüco. Das Cradle-to-Cradle-zertifizierte System wurde auf der gesamten Fassade umgesetzt, um einen einheitlichen Gesamteindruck zu erreichen und um – trotz der geringeren Effizienz auf der Nordseite – einen maximierten Gesamtertrag zu erzielen. Damit erreicht die Anlage in der Vertikalen eine Leistung von rund 180 000 kWh/Jahr. Übers Jahr gerechnet decken Fassaden- und Dach-PV mehr als die Hälfte des Gesamtenergiebedarfs in Bezug auf den Allgemeinstrom.
«Die Fassade erhält durch BIPV nichts Formalistisches, nichts Dekoratives, sondern bildet ganz im Sinne der Einfachheit nur die Nutzung und die Statik des Gebäudes ab», erklärt Architekt Nicolas Schrabeck. Das Gebäude wurde von Forster Fassadentechnik aus Mitterteich realisiert. ■